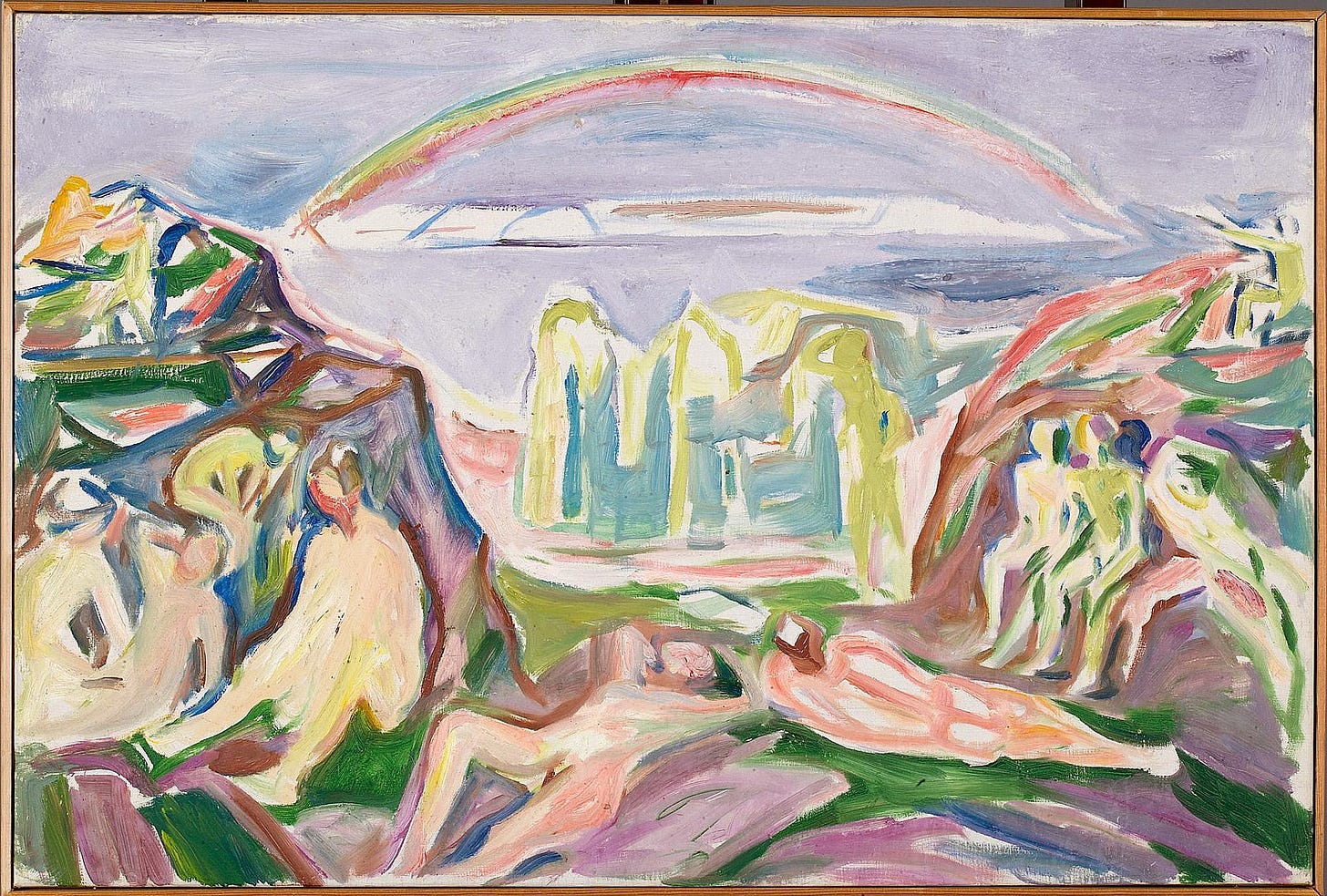Was bringt uns zum Denken? Die Antwort Hegels: Versöhnung. Versöhnung womit? Mit den Dingen, wie sie sind. Was aber, wenn einem der einmalige Schrecken des Totalitarismus jegliche »Instrumente für das Verstehen« genommen hat? Dann steht man vor denselben Fragen, die sich bereits Hannah Arendt gestellt hat.
Als Hannah Arendt 1943 zum ersten Mal von Auschwitz erfuhr, erwiderte sie: »Das hätte nicht geschehen dürfen.« Und doch war es geschehen. Und sie wusste, es hätte wieder geschehen können. Also verschrieb sie sich einer Welt, die offensichtlich nicht in Ordnung war. Über die innere Zerreißprobe, den Totalitarismus verstehen zu wollen, suchte sie Versöhnung. Nicht mit den totalitären Verbrechen, aber mit der Welt, in der sie geschahen. Mit einer Welt, die von menschlichen Wesen errichtet wurde und die nur menschliche Wesen ändern können. Einer Welt, in der man sich oft alleine fühlt, in der man aber nicht alleine ist.
»Was der Geist will, ist seinen eigenen Begriff erreichen; aber er selbst verdeckt sich denselben, ist stolz und voller Entfremdung seiner selbst.« — Hegel, Philosophie der Weltgeschichte [WT]
Die Schuldfrage als Kultur der Entwurzelung
Getrieben von dem bis heute tiefsten Anliegen aller Geschichtsphilosophie, Hegels gigantischem Unterfangen, »den Geist mit der Wirklichkeit zu versöhnen«, begann Arendt ihre Untersuchungen über das Bewältigen von Ungerechtigkeit: Wie ist Zukunft möglich in einer Gegenwart, die von der Vergangenheit anheimgefallen wird? Wie ist Frieden möglich, wenn die Schuldigen sich nicht ent-schuldigen? Und überhaupt: Wie ist es möglich, weiterzuleben, wenn man weder verzeihen noch vergessen kann?
Es war die Frage danach, wer die Verantwortung übernimmt »für alle Taten und Untaten, die von Menschen, welche anders sind als wir, verübt wurden». Denn obgleich es das Schuldig-Sein selbst war, das Jesus damit aus der Welt entfernen wollte, indem er sagte, »wie wir vergeben unseren Schuldigern«, lag hierin für Arendt der springende Punkt: Bei der Vergebung fehlt die Einsicht des Schuldigen. Wir nehmen ihm das Verstehen vorweg, indem wir Verständnis haben. Auf diese Weise jedoch werde Versöhnung unmöglich. Ihr Sinn läge schließlich darin, dass – im Unterschied zum Verzeihen – immer beide Seiten beteiligt sind. Und damit nicht genug: Die Geste der Verzeihung, führt Arendt fort, zerstöre »die Gleichheit und damit das Fundament menschlicher Beziehungen so radikal, dass eigentlich nach einem solchen Akt gar keine Beziehung mehr möglich sein sollte«.
Was also braucht es, damit der Mensch versteht? Wie lässt sich der seit Sokrates fortbestehende Zerfall von Denken und Handeln, von Sein und Erscheinung wieder miteinander versöhnen? Verstehen, so schrieb Arendt in ihr Denktagebuch, sei »die andere Seite des Handelns«. Als das Ende des Dagegen und Ankommen nach der Flucht vor der Freiheit ermöglicht uns das Verstehen, die Wirklichkeit zu begreifen und uns mit ihr zu versöhnen. Gleichzeitig jedoch galt es auch hier den Irrtum zu vermeiden, Verstehen mit Verzeihen gleichzusetzen. Verstehen impliziere immer nur: »Wir wissen nicht, was wir tun.« Verzeihen hingegen heißt: »to come to terms with«. Ich versöhne mich mit der Realität als solcher und gehöre ihr von nun an als Handelnder zu. Im Verstehen erzeuge ich nur Tiefe, aber noch keinen Sinn. Sinn bedeutet Verwurzelung: in der Welt ein Heim finden, sich zu Hause fühlen. Und Verwurzelung, so Arendt, fände sich nur in der Integration des Leidens, nicht im Zerdenken. Wer nur versteht und nicht fühlt, der sei »zur Oberfläche verdammt«.
Den eigenen Schmerz fühlen
Verstehen wird zum Einfühlen. Hierin erschloss sich für Arendt »eine ganz neue Sphäre des Innern«: Denn sobald der innere Sinn, Schmerz zu empfinden, zum Mit-Leid wird, und wir anfangen, über das Mit-leiden mit uns selbst das Mit-sich-selbst-Sprechen durch das Mit-fühlen zu ersetzen, erhebe sich das Verstehen, das sich auf die »Aussenwelt« richtet, zur Versöhnung im Sinne Hegels.
Bestand Hegels Intention ebenfalls in der »Versöhnung des ‹Gedankens› mit der Wirklichkeit«, ging es ihm nicht um die Versöhnung mit dem »Fremden«, sondern um das »Finden« des Selbst im anderen Medium. Das Wirkliche werde »de facto in Denkbares aufgelöst.« Überall begegne man sich selbst. In seiner Phänomenologie spricht Hegel in diesem Zusammenhang sogar von dem »Heraustreten [des] Innern in das Dasein der Rede«. Das Wort der Versöhnung sei hier »der daseiende Geist«. Nur diesem Geist, dessen Zufriedenheit mit sich selbst der Vernunft entspringt, sei es möglich, die Zerrissenheit des entwurzelten Daseins zu überwinden und die eigentliche Dimension der Tiefe durch geistiges Wurzelschlagen zu erzeugen. Allein diesem Geist sei es möglich – und hier sind wir wieder bei Arendt –, sich, weil er mit sich und ihr im Frieden ist, in dieser Welt zu Hause zu fühlen.
Die Erlösung der Gegenwart
Den äußeren Frieden stets als inneren Frieden jedes Einzelnen mit sich selbst betrachtend, war es dieser einfühlende Geist des »versöhnenden Verstehens«, in dessen Weltverwurzelung Arendt das entscheidende Gegengewicht zur blinden Verachtung der Rebellion und Resignation zu erkennen glaubte. In seiner dialogischen Konfrontation mit der Wirklichkeit erhoffte sie sich die Möglichkeit einer Versöhnung von Gegenwart und Vergangenheit. Für sie war klar: Erst wenn unser Urteilsvermögen befreit würde, kann eine freie Ausübung der Gedanken und damit auch ein freier Wille entstehen.
Gleich Friedrich Nietzsche schloss sie, dass allein »ein guter Wille« der Zeit gegenüber die Vergangenheit erlösen könne. Anders als er versuchte sie allerdings nicht, den Willen mit der Vergangenheit zu versöhnen, sondern das Urteilen über das Vergangene zu einer Art Impuls für das Gegenwärtige zu erheben. Anders als er, war sie keine Vertreterin der »Ewigen Wiederkehr«. Den Menschen darüber mit der Welt zu versöhnen, die Moral aufzulösen und ihn von seiner Verantwortung zu befreien und von jeder Zweckhaftigkeit und Kausalität zu befreien, hielt sie nicht für sinnvoll.
Verantwortung als Sinn im Handeln existierte für Arendt nur in der Gegenwart, im Diesseits und auf der Basis der eigenen Existenz. Weil das Denken als geistiges Vermögen, sich aus der Welt der Erscheinungen zurückziehen zu dürfen, nicht gleichzeitig Quelle des Sinns für die Welt sein konnte, sei das Denken über die Welt der Erscheinungen zurückzuführen. Es galt, über das Besondere zu reflektieren und so das Denken zum Urteilen werden zu lassen. Oder mit anderen Worten: Die höchste Funktion des Urteils besteht darin, Zeit und Weltlichkeit miteinander zu versöhnen. Während Verstehen «das Denken der Einsamkeit« ist, bedeutet Urteilen »das Denken des Zusammenseins«. Es ist die Verschmelzung von Geist und Wirklichkeit.
Urteilen, das war für Arendt gnadenloses Aufrechterhalten in und von der Gegenwart. Nur indem wir uns das Wunderbare der menschlichen Freiheit allzeit gewahr würden, könnten wir uns die Hoffnung für die Zukunft bewahren. Hierzu dürfe man trotz allem die Vergangenheit nicht ausgrenzen, sie gar verdrängen: »Ohne die Möglichkeit des rückwärts gewandten Urteils könnte uns für die Gegenwart durchaus ein Gefühl der Sinnlosigkeit überkommen, und wir könnten uns der Verzweiflung über die Zukunft ausliefern. Allein das Urteilen sorgt in zufriedenstellender Weise für den Sinn und gestattet uns so möglicherweise, unsere Bedingtheit zu bejahen.«
Dieser Text erschien zuerst in der Dezemberausgabe des Schweizer Magazin »Die Freien«.