Alles Leben ist Leiden
Nehmen wir unser Schicksal selbst in die Hand. Gedanken über Karma und Reinkarnation.
«In gewissem Grad sind wir wirklich das Wesen, das die andern in uns hineinsehen, Freunde wie Feinde. Und umgekehrt! Auch wir sind die Verfasser der andern; wir sind auf eine heimliche und unentrinnbare Weise verantwortlich für das Gesicht, das sie uns zeigen, verantwortlich nicht für ihre Anlage, aber für die Ausschöpfung dieser Anlage. Wir sind es, die dem Freunde, dessen Erstarrtsein uns bemüht, im Wege stehen, und zwar dadurch, daß unsere Meinung, er sei erstarrt, ein weiteres Glied in jener Kette ist, die ihn fesselt und langsam erwürgt. Wir wünschen ihm, daß er sich wandle, o ja, wir wünschen es ganzen Völkern! Aber darum sind wir noch lange nicht bereit, unsere Vorstellung von ihnen aufzugeben. Wir selber sind die letzten, die sie verwandeln. Wir halten uns für den Spiegel und ahnen nur selten, wie sehr der andere seinerseits eben der Spiegel unsres erstarrten Menschenbildes ist, unser Erzeugnis, unser Opfer.» — Max Frisch, Tagebuch 1946-1949
Womit helfen wir anderen Menschen wirklich? Indem wir Ihnen Entscheidungen abnehmen? Indem wir ihnen sagen, was sie besser tun oder lassen sollten? Indem wir uns quasi in dieselbe Art von Rolle begeben wie diejenigen, die derzeit das Denken für diese Menschen übernehmen, und immer schon übernommen haben? Und insofern diese es mit ihrer Gunst auch immer nur gut gemeint haben, sollten dann nicht auch wir uns einmal fragen, ob wir, wenn wir «helfen», dies wirklich zu ihrem Besten tun? Denn was ist dieses «Beste» in Wirklichkeit? Das Beste für uns, oder das Beste für denjenigen, dem wir meinen, dadurch zu helfen? Wie sähe unsere Hilfe aus, würde sie nicht von uns, sondern von dem – in unseren Augen – zu Helfenden ausgehen? Und mal ganz überhaupt: Läge die eigentliche Hilfe nicht vielleicht darin, aufzuhören, anderen Menschen helfen zu wollen?1
Vor Kurzem erhielt ich den Kommentar, ob es nicht eine Art der Eigenverantwortung sei, die anderen nicht sich selbst überlassen zu können, sondern «sie schützen, sie vom Abgrund fernhalten zu wollen». Man lebe ja schließlich mit ihnen zusammen. Und auch wenn der Versuch bewusst hoffnungslos sei, man hätte etwas unternommen.
Impulse wie diese kann ich gut nachvollziehen. Ich selbst neige dazu, für andere «mitzudenken». Dennoch versuche ich derzeit, eine andere Perspektive auf dieses Samariterdasein und seinen «Rettergedanken» einzunehmen. Schlicht und einfach aus dem Grund, weil die letzten vier Jahre mehr als deutlich gezeigt haben, dass wir niemanden «retten» können, der nicht gerettet werden will. Wir können nicht in den Bewusstwerdungsprozess anderer Menschen eingreifen; ihn weder steuern, noch beschleunigen. Die Menschen erkennen das, was sie erkennen können. Und auf dieses Können hat niemand von uns Einfluss. Der Mensch kann, was er können will. Und wenn er nicht will, kann unser Wollen daran auch nichts ändern. Eher im Gegenteil.
Demnach ist diese permanente Antizipation für mich eine Form des Egoismus. Anderen Menschen nur helfen zu wollen, um zu verhindern, dass «es» noch schlimmer wird? Ich empfinde das in gewisser Weise als heuchlerisch. Sag doch einfach, Du hast Angst davor, dass es noch schlimmer werden könnte und Du für dein Seelenheil die Gewissheit möchtest, dass du noch etwas hast verhindern wollen, bevor es – deiner Ansicht nach – zu spät gewesen ist. Aber zu sagen, dass man andere Menschen vor dem Abgrund bewahren will, wenn man eigentlich seinen eigenen Abgrund meint, empfinde ich als lieblos. Es hat den Menschen als solchen nicht im Blick.
Nicht genug, dass das Urteil darüber, was für diesen Menschen «Abgrund» bedeutet, von uns ausgeht, — wenn wir jemandem Ratschläge dahingehend geben, wie er dieses oder jenes Problem in seinem Leben lösen könnte, sprechen wir ihm insgeheim ab, selbst am besten zu wissen, was er sich für dieses wünscht. Nicht nur vermitteln wir ihm, dass wir insgeheim ein wenig schlauer sind als er, die Dinge in seinem Leben und um ihn herum vielleicht ein bisschen besser besser überblicken können als er, sondern geben ihm obendrein auch zu verstehen, dass die Kompetenz, über sein Leben zu entscheiden, nicht bei ihm, sondern bei uns läge, dass sein Leben nur dann in «geraden Bahnen» verlaufe, läge es in unseren Händen, nicht in seinen. Geblendet von unserer eigenen Barmherzigkeit, übersehen wir, dass unsere «Fürsorge» denselben Mechanismus bedient, wie die momentane Staatsräson:
Wir zwängen unser Gegenüber in die «Opferrolle» und nehmen ihm dadurch die Möglichkeit, für sich selbst Verantwortung zu übernehmen. Wir halten ihn klein, in einer von uns konstruierten Abhängigkeit. Und damit nicht genug: Indem wir ungefragt in sein Leben eingreifen, bespielen wir zugleich dieselben Kräfte, denen wir eigentlich ihren Nährboden zu entziehen versuchen. Wir erzeugen Willenslosigkeit, keine Willensstärke; Ohnmacht, keine Selbstermächtigung; Unfreiheit statt Freiheit. Wir begeben uns ins Außen, ohne die Möglichkeit, dabei wahrhaft konstruktiv zu wirken. Unsere Taten mögen «gut gemeint» sein, aber in ihrer Umsetzung sind sie nicht sinnhaft. Ihnen fehlt der Hebel; die Macht der Selbstwirksamkeit, derer wir unserem Gegenüber dadurch berauben, dass wir ihm das Denken abnehmen.
Die Frage, die ich mir stelle, besteht folglich darin, ob wir Menschen nicht nur nicht vor dem Schicksal ihrer eigens verursachten Unmündigkeit bewahren sollten, sondern es auch nicht einmal könnten? Denn worin besteht die eigentliche Auflösung von Unmündigkeit? Auf jeden Fall nicht darin, dass uns jemand von außerhalb sagt, warum wir besser so oder so zu handeln hätten, sondern darin, dass wir selber erkennen, welchen Maßstäben unser Handeln unterliegt. Hierzu können wir nur Impulse geben, aber niemals Anweisungen. Denn wenn der Betroffene dieser unserer Anleitung Folge leistete, entspränge seine Handlungsänderung nicht seiner eigenen Denkleistung. Es wäre das bloße Adaptieren der unsrigen. Und dass das weder Mündigkeit ist, noch zur Freiheit und Autonomie des Einzelnen beiträgt, sollte eigentlich jedem klar sein.
Wie aber wird der Mensch mündig? Meine vorläufige Antwort wäre: durch Leid. Durch eigens erlebtes Leid. Stützen tue ich mich hierbei auf den Buddhismus, demzufolge es drei Wege gibt, wie der Mensch zu Erkenntnis gelangen kann: durch eigenes Nachdenken, durch die Erzählung anderer, oder durch eigene Erfahrung. «Leben ist Leiden» als erste Edle Wahrheit, und damit als erste der Vier Aufgaben im Buddhismus, wird hierbei gewöhnlich als das Pali-Wort dukkha wiedergegeben. Dukkha wiederum unterscheidet drei Formen des Leidens: den körperlichen und geistigen Schmerz, mit den existenziellen Tatsachen des Menschseins wie Alter, Krankheit, Tod konfrontiert zu werden; das Leiden aufgrund von Unbeständigkeit und Veränderung, entweder nicht zu bekommen, was wir wollen, oder zu verlieren, was uns lieb und teuer ist; sowie zuletzt das Leiden an unserer metaphysischen Existenz – der Angst, ein verkörpertes und sterbliches Wesen zu sein, das der Bedingtheit der Existenz unterworfen ist, d. h. das Leben nie ganz unter Kontrolle zu haben.
Die zweite Edle Wahrheit besteht folglich in der Aufgabe, die Ursache allen Leidens im Verlangen und in der Anhaftung zu erkennen: Wir gehen durchs Leben und greifen nach Dingen, klammern uns an das, von dem wir glauben, dass es uns befriedigt und vermeiden das, was uns stört. Ein Irrtum, den die dritte Aufgabe (Edle Wahrheit) dadurch versucht aufzulösen, indem sie uns lehrt: Unser Leiden kann nur dann enden, wenn wir aufhören, uns an das zu klammern, von dem wir glauben, ohne nicht leben zu können. Es sei an uns, zu erkennen, dass unsere Zufriedenheit nicht von äußeren Objekten oder Ereignissen abhängt, sondern aus einem kultivierten Geisteszustand hervorgeht, auf den die Umstände keinen Einfluss mehr haben. Diese Praxis des Achtgliedrigen Pfades lehrt schlussendlich die vierte Edle Wahrheit:
WEISHEIT
1. Rechte Ansicht (sammā diṭṭhi)
2. Rechtes Denken (sammā saṅkappa)ETHIK
3. Rechte Rede (sammā vācā)
4. Rechtes Handeln (sammā kammanta)
5. Rechter Lebenserwerb (sammā ājīva)GEISTESSCHULUNG
6. Rechte Anstrengung (sammā vāyāma)
7. Rechte Achtsamkeit (sammā sati)
8. Rechte Konzentration (sammā samādhi)
ㅤ
Wir kommen leidend auf diese Welt. Doch die Art und Weise, wie wir mit unserem Leiden umgehen; ob wir es als das unsrige erkennen und versuchen, es als solches aufzulösen, oder ob wir es verdrängen und uns lieber am Außen abarbeiten, bestimmt letztendlich über unser Karma. Dessen ursächlicher Gedanke des Samsara, dem Kreislauf von Existenzen, von Tod und Wiedergeburt, in dem sich jedes Lebewesen befindet, besagt schließlich, dass wir hier auf Erden nicht als tabula rasa geboren werden: Wir kommen auf die Welt und tragen bereits unser Päckchen an Durck, Furcht und Verstrickung mit uns. Es ist die Haltung, die wir unserem Unterbewussten gegenüber einnehmen, die bestimmt, ob die «Last», mit der wir unser Leben betreten haben, am Ende von diesem kleiner sein wird, oder ob wir uns insgeheim dazu entschließen, noch eine Runde mit denselben Startbedingungen zu drehen.
Aus diesem Grund bedeutet zu leiden, immer auch zu lernen. Es meint, differenzieren zu lernen zwischen dem, was in uns wütet und dem Kampf, der dieser Welt derzeit noch anhaftet. Genauso wie wir lernen müssen, ihr Leiden bei ihr zu lassen, müssen wir auch lernen, unser Leiden nicht in die Welt zu tragen, es nicht anderen anzulasten, sondern es mit uns selbst auszumachen. Es gibt keinen anderen Weg, es aufzulösen. In diesem Perspektivwechse ruht der Weg, langfristig etwas an dem Leiden zu ändern, das uns alle betrifft: Zu verstehen, dass es nicht darum geht, das Böse in der Welt zu bekämpfen, sondern dass man es dadurch versucht aufzulösen, dass man es integriert; es nicht als etwas Vernichtenswertes betrachtet, sondern als etwas aus der Balance Geratenes, etwas, zu dem wir, um es aufzulösen, bloß eine andere Haltung gegenüber einnehmen müssten, um seinem Wüten Einhalt zu gebieten. Erst indem wir unser eigenes Leiden als das erkennen, was es ist: das unsrige – und damit ein Spiegel dessen, von wem oder was in dieser Welt wir uns noch nicht haben befreien können – können wir es auflösen und tragen so unseren Teil zu dem globalen, dem kosmischen Ganzen bei, dessen Leiden wir eben nicht durch Übergriffigkeit, durch Einmischen und Fremdvorschläge lösen können, sondern einzig dadurch, dass wir bei uns selber anfangen.
ㅤ
ㅤㅤ
Ignorieren wir jedoch das, was uns unser Schmerz sagen will, verfehlen wir unseren eigenen Lebensplan. Diesem zufolge kommen wir bereits mit einer Aufgabe auf die Welt, haben sie uns vor unserer Reinkarnation selbst ausgesucht. Eben um in diesem Leben an ihnen zu wachsen, um nicht sinnlos auf diese Erde gekommen zu sein. In diesem Perspektivwechsel liegt für mich der Schlüssel: Zu erkennen, dass niemandem damit geholfen ist, wenn wir ihm seine Aufgaben versuchen abzunehmen. Das blockiert das Kollektive. Wachstum kann nur stattfinden, wenn jeder an sich selber arbeitet. Es geht darum, dass am Ende seines Lebens jeder sich sich selbst eine andere Ausgangslage erarbeitet hat, als jene, mit der er auf diese Welt gekommen ist. Das ist der klassische Karmagedanke. Kümmere dich um dein eigenes Karma. Darin besteht die ganze Kunst: Sich nicht abzuwenden von der Schwere, von der Härte, den Qualen der eigenen Existenz; Ablenkung von Ihnen in der Heilsbringung für andere zu suchen, sondern sie als das anzunehmen, was sie sind: Wachstum. Wachstum im Sinne einer kollektiven Bewusstseinserweiterung. Wir alle sind hier aus einem Grund. Und es ist unsere Pflicht, diese für uns zu erkennen und anzunehmen.
Nur indem wir unsere eigene Lebensaufgabe erkennen, ist es uns als Individuen überhaupt erst möglich, diesen ganzen Wumms hier ein Stück nach vorne zu bringen. Genauso gilt: Ignorieren oder verfehlen wir sie, fallen wir als Ganzes zurück. Niemand ist losgelöst. Und doch sind wir in dem Sinne alle auf uns selbst gestellt. In dieser Metaebene besteht das eigentliche Erwachen: Zu erkennen, dass es auf dieser Welt zwar insofern nicht um uns geht; dass es aber damit es dieser Erde als Ganzes besser gehen kann, in unserem Leben um uns gehen muss. Es geht schon darum, Verantwortung zu übernehmen. Aber eben jeder für sich und auf seine Weise: Indem wir für uns Verantwortung übernehmen, übernehmen wir auch Verantwortung für das große Ganze, von dem wir nun einmal Teil sind und von dem wir uns auch nicht lösen können. Und als solcher können wir einander zwar zusprechen und Stütze sein, aber auch nur insoweit, wie wir dem anderen den Halt und den Raum bieten, damit er die nötige Kraft aufbringen kann, seine Aufgaben alleine zu bewältigen.
Mit alleine bewältigen ist nicht gemeint, dass jeder Mensch in dieser Welt ein Einzelkämpfer sein muss. Nein. Für mich geht es darum, insoweit Gemeinschaften zu bilden, dass jeder Mensch in sich die Stärke entwickeln kann, die er braucht, um sich den Aufgaben, die dieses Leben für ihn bereit hält, gewachsen zu fühlen. Denn ganz ohne Rückkopplung geht es meines Erachtens auch nicht. Wäre die Welt zwar zweifelsfrei eine andere, würde auch nur ein Bruchteil der Menschheit von heute auf morgen zum Buddhismus konvertieren, ist die Lage derzeit zu ernst, um ihr allein dadurch etwas «entgegenzusetzen», dass man die anderen mit ihr alleine lässt. Es ist das eine, dahingehend an sich selbst zu arbeiten, die Überriffigkeit von Staat und Fernsehen keine Macht mehr über einen selbst erzielen zu lassen. Es ist etwas anderes, die dadurch gewonnene Macht nicht dahingehend zu nutzen, der Verfolgung von Leib und Leben, Eigentum und Gedanken, Freiheit und Würde dahingehend etwas entgegenzusetzen; sie nicht mit denselben Mitteln zu bekämpfen, sondern die eigene Stärke dahingehend zu nutzen, anderen Menschen die Furcht vor ihr zu nehmen.
Letztlich ist das, was wir hier erleben, eine Karosserie an Schrumpfungsmaßnahmen: Der Mensch wird klein gemacht und klein gehalten, bis er von sich selber glaubt, er sei all’ dem derart ausgeliefert und stünde all’ dem derart ohnmächtig und mittellos gegenüber, dass er nicht anders könne, als sich dem aktuell bestehenden Regime unterzuordnen. Er glaubt, auf seine Gunst angewiesen zu sein, nur um nicht selber jede Leistung, von der er ohnehin glaubt, er könne sie nicht leisten, erbringen zu müssen, — die es aber bräuchte, wolle er ein eigenständiger, ein mündiger, ein fühlender, ein lebendiger Mensch werden. Ein Mensch, der an sich selber glaubt. Für mich ist das Gemeinschaft: Aufeinander zu schauen, den Einzelnen nie aus dem Blick zu verlieren; und trotz allem zu verstehen, dass das, was wir in diesem Leben aneinander finden, nur die Wiederbegegnung und Fortführung eines Früheren ist.
… Und vielleicht besteht der Anfang dieser Form von «Hilfe» schlussendlich darin, auch einfach mal nur zuzuhören. Füreinander da zu sein. Wahrhaftig zu sein.
Und um es zu guter Letzt mit dem wunderbaren Egon Friedell noch einmal mehr als klar und anschaulich zusammenzufassen2:
«Der Zweck des Lebens kann doch niemals die Aufhebung des Lebens sein, und das ist im letzten Sinne jedes unfreiwillige Opfer. Blicken wir einmal auf alle die großen Männer, die Wohltäter der Menschheit: Haben sie etwa den Sinn ihres Lebens in der Selbstentäußerung, im Leiden und Arbeiten für andere erblickt? Keineswegs. Sie sahen ihre höchste und heiligste Mission darin, für sich zu leben und zu leiden, das Gesetz ihrer Seele zu ergründen, den göttlichen Plan ihres Daseins zu erfüllen. War etwa das Leben Goethes, Beethovens, Bismarcks oder Schopenhauers eine ununterbrochene Kette von Opfern? Wenn diese Männer sich immer mit dem Wohl der andern beschäftigt hätten, wären sie niemals zu sich selbst gekommen, wären sie niemals groß geworden. Leider Gottes kümmern sich die meisten Menschen viel zu wenig um ihr «liebes Ich»; deshalb sind sie ja solche Dummköpfe. Was unterscheidet denn den tiefen Denker vom gedankenlosen Durchschnittsmenschen? Daß er Tag und Nacht über sich nachdenkt, sich «mit sich selbst beschäftigt». Und das religiöse Genie? Es grübelt ununterbrochen über sich, über seine Stellung zu Gott und dem Weltall: Nur von diesem Punkt aus vermag es dann auch das Schicksal der andern mitfühlend zu begreifen. Jesus und Buddha begaben sich in die Wüste und beschäftigten sich dort ausschließlich mit sich selbst. Es liegt in diesem Entschluß, mit sich selbst in Verkehr zu treten, ein ungeheurer Heroismus, denn es ist gar nicht so ungefährlich, dieses Geschäft der Autovivisektion. Und warum hat Jesus sich für die Menschheit geopfert? Weil es seine persönliche, individuelle, gottgewollte Bestimmung war, nicht die aller Menschen. Hat er etwa seinen Jüngern gepredigt: Lasset euch kreuzigen? Durchaus nicht. Nicht jeder hat das Recht, sich kreuzigen zu lassen. Er lehrte sie: Tue jeder das Seine. Erfülle jeder seine Bestimmung, das, was Gott mit ihm vorhatte, genau das und nur das. Sehe jeder erst, wozu er selber da ist, bevor er sich zudringlich um das Wohl anderer kümmert.»
Zweifelsfrei muss man hier unterscheiden zwischen Hilfe in der Not: Verkehrsunfälle, Ertrinken, Menschen vor dem Hunger zu bewahren, usw. Das meine ich in diesem Zusammenhang natürlich nicht.
Egon Friedell (2009): Vom Schaltwerk der Gedanken. Ausgewählte Essays: Der Zweck des Lebens. Zuerst erschienen in Neues Wiener Journal 26.11.1916. Diogenes.







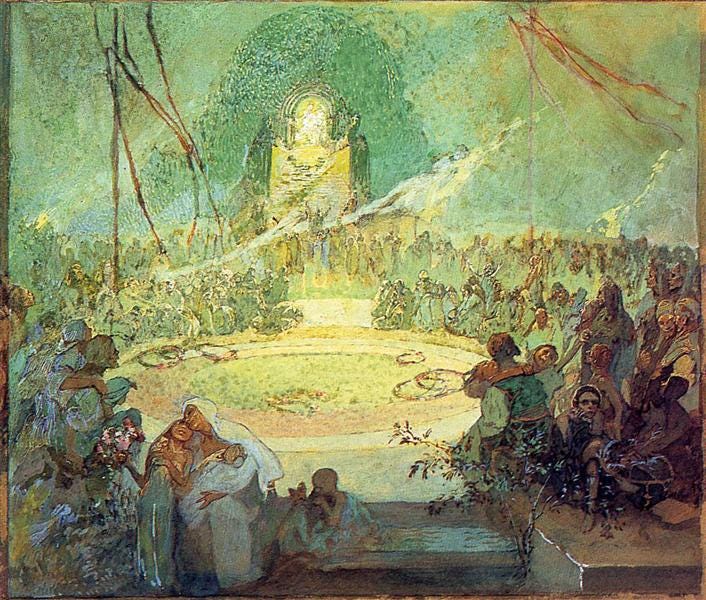

Wie wahr, Selbsterkenntnis, Vorbild sein im eigenen Bemühen, und genau differenzieren, wo kann ich eine Anregung geben für den Anderen (wir sehen beim Anderen meist besser als bei uns selbst und benötigen deshalb auch das Feedback der Anderen für uns auf unserem Weg) und wo muss ich, so schmerzhaft es ist, schweigen, zuschauen, nur dabei bleiben, begleiten... Das ist oft am schwersten bei den Menschen, die man am meisten liebt. Für mich bleibt die Frage: wo muss ich aktiv werden gegenüber dem "Bösen" in der Welt, der Ungerechtigkeit, entsprechend dem Spruch: Wer Böses sieht und hindern kann und doch nichts tut ist schuld daran? Daran sind Menschen beteiligt, die in ihrem Prozess der Selbsterkenntnis nicht verstehen, dass ALLES was sie tun auch, oder vor allem Spuren in IHREM EIGENEN Lichtkörper hinterlässt.
Wunderbar geschrieben und enthält auch so einige Gedanken, die ich mir in letzter Zeit gemacht habe. Wer sagt denn, dass man selbst die "richtige" Einstellung, Sichtweise, Lebensweise etc. pp. hat? Ist es nicht unglaublich arrogant zu glauben, dem anderen sagen zu können oder gar zu müssen, was richtig und was falsch ist? Wie fühle ich mich, wenn mir jemand sagt, was das Beste für mich ist? Was nützt mir das? Würde ich die Dinge annehmen? Im besten Fall, aber auch nur dann, würde ich mir wirklich Gedanken machen - in den meisten Fällen, stände ich dem ablehnend gegenüber. Und wenn ich so denke und fühle - wie kann ich dann glauben, dass der andere es im umgekehrten Fall wundervoll findet?
Mal wieder trifft das Sprichwort in mehr als einer Hinsicht zu: Jeder sollte zuerst vor seiner Tür kehren.
So gesehen kann ich nur mich selbst und andere ermuntern Selbstverantwortung für sich und sein Leben zu übernehmen.