Der Mensch in der asketischen Revolte
Von Fentanyl bis Bindungstrauma: Die Welt verschwindet, wenn wir in ihr aufgehen.
«Gelehrte Unzufriedenheit» galt bereits Ernst Bloch zufolge als «Motor der Geschichte». Entsprechend geläufig ist es, das Jahr mit guten Vorsätzen zu beginnen. Es wird gefastet, kein Alkohol getrunken, ein Jahresabonnement im Fitnesstudio abgeschlossen oder sich Sirsa Padasana als nächst schwierige Yogapose zum Ziel genommen. Doch während der eine bereits den ersten Geburtstag irgendeines Bekannten zum Anlass nimmt, erneut zu trinken, bleibt ein Großteil aller Fitnessabos ab Mitte Februar ungenutzt, und die Yogavideos werden wieder aus der Playlist gelöscht. Mangelndes Durchhaltevermögen? Ich tendiere zu: falsche Zielsetzung.
Denn warum nehmen wir uns derartige Dinge vor? Weil wir meinen, dass sie gut für uns seien. Weil wir das Gefühl haben, dass uns etwas fehlt und weil wir – ohne uns das aktiv einzugestehen – spüren, wie wir uns verfehlen, machten wir weiter wie zuvor. Da ist diese Sehnsucht, etwas bislang Ungelebtes integrieren zu wollen. Anstatt sie jedoch direkt zu adressieren und zu verstehen, woher sie wirklich kommt, verfallen wir in Übersprungshandlungen und Kompensationsmechanismen, die den Kern unserer Sehnsucht nur noch weiter von uns wegschieben. Aus dem Wunsch heraus, «die beste Version unserer Selbst» zu werden, distanzieren wir uns von uns selbst; verleugnen dieses Selbst. Uns geht es nicht darum, wir selbst zu werden. Vielmehr optimieren wir das, von dem wir glauben, es sein zu wollen. Und öffnen somit Erwartungen die Tür, die letzten Endes nicht uns entspringen, sondern dem, was wir glauben, es sein zu müssen. Kurzum: Solange wir das Bild, das wir von uns selber haben, nicht aus uns selbst heraus entwickeln, sondern übernehmen, kann und wird es nie unser eigenes sein; werden auch wir nie ganz wir selbst sein. Wodurch auch die Sehnsucht nach dem, was wir uns eigentlich wünschen, auf immer eines bleibt: ungelebt.
ㅤ
Wie aber adressieren wir diese Sehnsucht und woher kommt sie? Wie machen wir uns frei von dem, was uns immer hat unfrei fühlen lassen? Welchen Weg müssen wir gehen, um bei uns selbst anzukommen?
Dem Traumatherapeuten Gopal Norbert Klein zufolge lassen sich jene Leiden, die uns meist seit unserer Kindheit begleiten und seither in allen Beziehungen auftauchen, auf Traumata zurückführen. Oder konkreter: auf Bindungstraumata. Diese erfahren wir, so Gopal, oft als ein Leiden, das scheinbar nicht zu lösen ist – egal wie sehr wir uns anstrengen, oder versuchen, es loszulassen. Entsprechend ohne Aussicht, uns von ihm zu befreien, entwickeln wir Mechanismen, auch mit ihm bestmöglich durchs Leben zu kommen. Ein Unterfangen, das je nach Schwere des Traumas, oder auch der zur Verfügung stehenden Ressourcen, funktionieren mag – eine Zeit lang. Denn während dieses Leiden für manche Menschen so groß ist, dass sie sich in Traumatherapie begeben, realisieren auch weniger stark Betroffene ab einem gewissen Moment, dass sie, um ihre Sehnsucht nicht länger kompensieren zu müssen, sondern endlich leben zu können, auch ihr Leiden nicht länger unterdrücken, sondern auflösen wollen. Worin nämlich besteht diese Sehnsucht, in deren Ungelebtsein wir uns permanent selbst verleugnen? Laut Gopal ist es unser unerfüllter Wunsch nach Nähe und Verbundenheit, der uns zeitlebens immer wieder Chaos, Drama und Leid erschaffen lässt. Und durch den sich unser gesamtes Leben – und mit ihm alle von uns durchlebte Leere mitsamt ihrer Versuche, diese bestmöglich nicht fühlen zu müssen – solange auf Bindungstraumata zurückführen lässt, wie wir diese nicht gelöst bekommen.
Doch wie genau entstehen Bindungstraumata? Und wie machen sie sich bemerkbar? – Anders als bei einem Schocktrauma, welches meist auf eine konkrete Situation zurückzuführen ist, spricht Gopal von Entwicklungs- und Bindungstraumata, «wenn in der Kindheit Dinge passieren, die so gravierend sind, dass sie die gesamte Entwicklung der Persönlichkeit stören und somit zu scheinbar nicht auflösbaren Leiden als Erwachsener führen»1. Könne zwar auch ein Schocktrauma zu späteren Entwicklungstraumata führen, seien es jedoch fast immer «destruktive Beziehungsmuster der Bezugspersonen zum Kind, die dafür verantwortlich sind». An ihnen, so Gopal, leiden wir nicht nur individuell, sondern auch kollektiv als Gesellschaft. Einzeln wie gemeinsam sei uns eines nicht möglich: eine ehrliche Kommunikation unserer Bedürfnisse. Doch dazu später mehr.
Ein Bindungstrauma also ist nicht auf einen einmaligen Ausraster der Eltern zurückzuführen, sondern vielmehr das Ergebnis dauerhaft destruktiver Beziehungsmuster, das die Eltern oder andere Bezugspersonen dem Kind aus dem Grund gegenüber leben, weil «die Eltern selbst wenig beziehungsfähig sind und aufgrund eigener Traumatisierungen in irgendeiner Weise dauerhaft destruktiv auf das Kind einwirken». Was letztendlich bedeute, «dass sie in irgendeiner Form Distanz zu ihrem Kind herstellen müssen, weil sie den vollständigen Kontakt nicht aushalten». Oder mit anderen Worten: Um selbst nicht an ihre schlechten Erfahrungen als Kinder erinnert zu werden, unterdrücken sie ihr Bedürfnis nach Nähe in sich selbst genauso wie nach außen in ihrem Kind. Sie «wehren im Kind das ab, was sie auch in sich selbst abwehren». Insofern eine intakte Beziehung zu seinen Eltern nun aber für ein Kind lebensnotwendig ist und es sich entsprechend «nicht leisten kann», das Verhalten seiner Eltern infrage zu stellen, beginnt es, seine Bedürfnisse zu unterdrücken und sich die Schuld an allem zu geben, was es als schmerzhaft empfindet. Diese Illusion von Kontrolle, so Gopal, gehe einher mit dem, was man toxische Scham nenne: «Meine Bedürfnisse sind falsch», bis hin zu «Ich bin falsch». Die unterdrückten Gefühle von Wut und Traurigkeit können hierbei sogar zu Depressionen, anderen Krankheiten oder Süchten, oder im Extremfall zu dem Wunsch führen, nicht mehr leben zu wollen.
Aus diesen Erfahrungen heraus, Begegnung und Beziehung mit Gefahr zu assoziieren, entwickeln wir Strategien, um den als bedrohlich erlebten Kontakt zu vermeiden. Wir bauen Mauern, um uns zu schützen, oder vergessen, was dieses «Selbst» einmal war und gehen stattdessen auf in der Oberflächlichkeit von Bekanntschaft. Doch obgleich die dahinter liegende Idee entweder lautet: «Wenn ich möglichst autonom bin, niemanden brauche, dann erlebe ich auch keine Grenzüberschreitung mehr», oder: «Wenn ich alles tue, um den anderen zu erreichen, dann erlebe ich auch keine Einsamkeit durch Vernachlässigung mehr»2 – der ihnen zugrunde liegende Impuls ist derselbe: Angst. Weil wir nie erfahren haben, wie sich Sicherheit in Beziehungen anfühlen kann, haben wir Angst, diese einzugehen. Wir glauben, als die, die wir sind, nicht liebenswert zu sein. Und gehen aus dem Grund entweder überhaupt keine Beziehungen ein, oder Beziehungen, in denen wir nicht wir selbst sind.
ㅤ
ㅤ
Ein Mechanismus, den Martin Heidegger vor knapp hundert Jahren bereits in Sein und Zeit beschrieb: «Das Dasein ist im Aufgehen in der besorgten Welt, das heißt zugleich im Mitsein zu den Anderen, nicht es selbst.»3. Und an anderer Stelle: «Das Aufgehen im Man und bei der besorgten ‹Welt› offenbart so etwas wie eine Flucht des Daseins vor ihm selbst als eigentlichem Selbst-sein-können.»4 Solange wir nicht in Beziehung und Verbundenheit sind, suchen wir nach Ausflüchten, selbst ihre Abwesenheit nicht spüren zu müssen. Laut Gopal äußern sich diese Ablenkungsversuche in Konsum, Rückzug und/oder Betäubung, aber auch durch übermäßige Einmischung in das Leben anderer, bis hin zu der selbstlosen Mission, das Klima der Erde retten zu wollen.
Mit anderen Worten: Mangels Raum, mit anderen wir selbst zu sein, stürzen wir uns in eine Form von Aktivismus, in dem wir vor lauter Beschäftigtsein nicht nur nicht merken, wie all’ der Kontakt, den wir nach außen hin haben, uns nicht adressiert, sondern dass wir es letzten Endes nicht einmal sind – «in Kontakt». Die Person, um die wir uns eigentlich kümmern sollten, wären schließlich wir selbst. Denn kümmern wir uns nicht um uns selbst und sind wir nicht in Kontakt mit unseren eigenen Bedürfnissen, werden diese auch in keinem anderen Kontakt zutage treten. Es ist diese Kontaktarmut zu uns selbst, die letzten Endes auch jede weitere Beziehung beziehungslos werden lässt. Indem nicht einmal wir unsere Bedürfnisse kennen, können wir sie auch anderen gegenüber nicht artikulieren. Während wir uns selbst immer fremder werden, verblassen wir auch im Kontakt zu anderen. Als «Man» kümmern wir uns um alle und die ganze Welt – nur nicht um uns selbst. Gopal nennt dies den Verschmelzungstyp.
Sein Gegenpart ist der Autonomietyp. Anders als der Verschmelzungstyp wahrt der Autonomietyp seinen eigenen Raum. Er braucht keine anderen Menschen. Er kümmert sich lieber um sich und seine Unabhängigkeit. Das Ganze geht vielleicht so weit, dass der Autonomietyp allein schon beim Gedanken an Kontakt – egal wie oberflächlich er sein mag – zusammenzuckt. Berührungen sind ihm fremd, in seiner Weltentzogenheit gibt es keine Nähe. Er lebt asketisch und betrachtet seinen Weg als den einzig richtigen, um in dieser Welt zu überleben.
Eine Haltung, die gerade bei Literaten zur Krankheit werden kann. Sie haben ihre Bücher. Und mit ihnen ganze Welten, die ihnen offenstehen. Und die sie wieder schließen können, sobald ihnen der Sinn danach steht. Da sind keine Diskussionen, keine unangenehmen Grenzziehungen oder Gefühlsoffenlegungen. Und falls doch, dann sind sie Fiktion und haben mit einem selbst nur so viel zu tun, wie man dies zulässt… Und für den, dem die reale und die fiktionale Welt abhandengekommen sind? Für den gab es zu allen Zeiten immer noch die Welt des Rauschs.
Wie die Sucht zur Droge fand
Denn was letztendlich ist es, was sowohl der Verschmelzungstyp in seiner Verschmelzung als auch der Autonomietyp in seiner Autonomie zu finden hofft? Erlösung. Erlösung von dem Schmerz jener fehlenden Verbindung, die er nie gelernt hat, auf anderem – «gesundem» – Wege herzustellen. Erlösung, so schreibt Peter Sloterdijk an dieser Stelle, «ist die Erleichterung, die sich einstellt, wenn man über eine Technik verfügt, aus Teufelskreisen auszusteigen.»5 Während sich die Moderne also auf therapeutische Strategien geworfen hat, «um mit den Übeln, auf die sich die alte Erlösungssehnsucht bezog, fertig zu werden», drehte sich ihr übergeordnetes Narrativ mehr darum, dem Menschen seine Sehnsucht auszureden, als ihm zu zeigen, worin diese ihrem Wesen nach besteht. Statt den Menschen also darin zu bekräftigen, für sich Wege zu finden, das, wonach er sich in Wahrheit sehnt – die tiefe Verbundenheit zu anderen Menschen –, zu leben, lässt man ihn glauben, dass «mit Hilfe der großen asketischen Verneinung der leidenerzeugende Mechanismus, die Weltsucht, geheilt und die Gier nach Macht im Wirklichen abgemildert»6 würde.
Ein laut Gopal großer Irrtum. Hat unser Organismus im Grunde doch kein Bedürfnis nach Therapie, Somatic Experiencing (SE), Tension und Trauma Release Exercises (TRE) oder Vagusübungen, sondern nach Kontakt, Nähe und tiefen Beziehungen.
«Die Abwesenheit von Schmerz bedeutet die Gegenwart von Welt. Die Gegenwart von Schmerz bedeutet die Abwesenheit von Welt. Mittels dieser Gleichung wird aus Schmerz Macht.»
— Elaine Scarry, The Body in Pain
Solange dieses jedoch nicht erkannt, sondern weiterhin verdrängt und kompensiert wird, fasst das Erlösungsverlangen dadurch Fuß in dieser Welt, als dass es diese verneint. Der Mensch, so meine Beobachtung, wird insofern zur Askese erzogen, als dass er lernt, auf alles zu verzichten und nichts mehr zu wollen, was ihn tatsächlich nähren könnte. Tiefgreifende Beziehungen? Nein Danke. Ein Leben in Gemeinschaft? Bloß nicht. Einem anderen Menschen anvertrauen, wie wir uns wirklich fühlen? Alles, nur das nicht. Und mit «alles» scheinen wir wirklich «alles» zu meinen. Mich wundert es zumindest nicht (erschrecken schon), dass zuerst die USA und mittlerweile auch Hamburg oder Frankfurt im Fentanylrausch versinken7: Bedürfnisse hören nicht auf zu existieren, nur weil man sie missachtet. Dabei seien es diese unwillkürlichen Riesenkämpfe, in denen, so schreibt auch Sloterdijk, Menschen seit langem versuchen, «das unverhältnismäßig schwer gewordene Gewicht der Welt zu manipulieren: indem sie es teilen und gemeinsam tragen; indem sie es durch Bedürfniseinschränkung reduzieren; indem sie es auf andere abwälzen; indem sie es, nicht zuletzt mit Hilfe von Rauschmitteln, in der Betäubung vergessen und überfliegen.»8
Was Ernst Jünger in seinen Annäherungen noch romantisiert als «Siegeszug der Pflanze durch die Psyche»9 beschrieb, hat die Kombination aus Pansch, Pfusch und Not derweilen mehr zum Zusammenbruch der Psyche werden lassen, als dass sie ihr beim Ausbruch aus der ihr so verhassten Realität geholfen hätten. Zumindest scheinen auf den Straßen San Franciscos10 die Fragen nach Bewusstseinserweiterung – insofern sie jemals da gewesen sind – längst erloschen. Und während die Situation in Philadelphia11 deutlich macht, wie Kompensation und Verdrängung als Verlust jeglichen Selbst- und Weltbezugs am Ende aussehen kann, sind es folgende Fragen, die sich in mir breitmachen: Wie konnte es so weit kommen und warum greift niemand ein? Ist das bloß die offen zutage getretene Konsequenz einer Gesellschaft, die ihre wahren Probleme verdrängt? Und – zu guter Letzt: Ist das gewollt? Oder wird es bloß zugelassen? … Und läuft das letzten Endes nicht auf dasselbe hinaus?
Sagen wir’s so: «Je profunder die Drogenerfahrung, desto unmöglicher die Sucht.»12 Eine Beschreibung, die womöglich mehr Albert Hofman, Aldous Huxley oder Timothy Leary entsprach. Anders als viele Zeremonienmeister heute, gelten sie für mich noch als wahre Suchende, keine fliehenden Realitätsverweigerer. Wenngleich Realität hier auch nicht der richtige Begriff sein mag: Vertraten alle drei doch eher die Ansicht, dass das, was uns hier als «Realität» verkauft wird, nur eine sehr sehr traurige Version dessen ist, wozu der menschliche Geist fähig wäre. Während die Frage, die sie auf ihrem Weg nach den ungelösten Rätseln der Bewusstseinsgeschichte noch antrieb, entsprechend lautete, «wieso das Subjekt, in dem Maße, wie seine Undurchlässigkeit für Gott und Götter steigt, anfälliger wird für die Überwältigung durch Drogen»13, scheint die Gottlosigkeit unserer Zeit ein solches Ausmaß angenommen zu haben, als dass sie sich für viele ohne Drogen kaum mehr aushalten lässt. Das, wovor Huxley mit seiner Schönen Neuen Welt noch versucht hat zu warnen, scheint derweilen stärker, als dass der durchschnittlich menschliche Geist über Ressourcen verfüge, ihrer Totalität gewachsen zu sein. Geschweige denn auch nur dazu imstande wäre, sie als das Gefängnis zu erkennen, das sie bereits ist.
Die «Realität», so behauptet es nicht nur Harari, hat uns eingeholt. War es zuvor noch die psychologisch angetriebene Frage, ob es «von Natur aus zur Sucht ‹disponierte› Individuen gäbe?»14, müsste die Frage im Anbetracht der Umstände vielmehr lauten, ob es nicht vielmehr Zeiten sind, die ihrer Natur nach den Menschen zur Sucht disponieren? Ich mein: Entspricht das «Leben» als solches zusehends mehr der Folter, ist es ab einem gewissen Punkt weder verwunderlich, noch verwerflich, sucht der Mensch nach Mitteln der Dissoziation. Ähnlich wie bei einem Schocktrauma versucht die Psyche jene noch intakten Anteile an einen Ort abzuspalten, an dem sie von der eigentlichen Verletzung unversehrt bleiben. Leider jedoch scheint es für die durch Crack, Fentanyl oder Crystal Meth betroffenen Anteile – anders als in der Traumatherapie – kein «Zurück» mehr zu geben. In ihrem Versuch, nicht noch Schlimmeres zu erleiden, hat sich die Psyche nicht beschützt, sondern selbst zerstört.
Oder wie Sloterdijk es beschreibt: «Zu den tragischen Lektionen der Droge gehört es, dass sie es dem Menschen verbietet, ein Privatverhältnis zu dem Überwältigenden aufzubauen. Unter Bedingungen des Privatkonsums nämlich erfüllt jede psychotropische Substanz früher oder später die Definition des Dämonischen. In der Beziehung zum Dämon verliert das Subjekt seinen Willen an den stärkeren Partner.»15 Oder an anderer Stelle: «Zur Herrin der Seele wird die Droge nur als private und heimliche Dienerin der Nichtseinstendenz.»16
Zwischen Ekstase und Weltverzicht
Ich fasse zusammen: Auf der einen Seite haben wir ein fortführend traumatisiertes Generationenverhältnis, das – wie von Harari beschrieben – die Kernfamilie immer weiter voneinander entfremden und letztendlich zerbrechen lässt. Selbstverständlich unter Beihilfe der Globalisierung samt all’ ihren menschenfeindlichen Nebeneffekten. Das Individuum wiederum findet sich dadurch in einer gleich dreifachen Haltlosigkeit wieder: Nicht nur ist der Mensch nicht mehr eingebettet in ein soziales Gefüge, das ihn auffängt, wenn er an dieser Welt kollabiert – er verfügt darüber hinaus auch über keine inneren Ressourcen mehr, um sich selbst den Halt zu bieten, an dieser Welt gar nicht erst kollabieren zu müssen. Ist sie doch die letzte Wirklichkeit, die ihm geblieben ist. An ein «da oben» hat er – neben sich selbst – schließlich ebenfalls längst aufgehört zu glauben. Dabei wäre der Glaube an seine Existenz vielleicht entscheidend, um den anderweitig «verloren» gegangenen Halt wieder herzustellen.
So siegessicher die Rede von Harari nämlich auch klingen mag – mich überzeugt sie nicht. Ich glaube schlichtweg nicht daran, dass sich die Menschheit – gleich wenn bei Harari auch nur von dem «reichen» Teil der Menschheit die Rede ist – in eine Singularität speisen lässt und sich entsprechend auf technischer Ebene von ihrer organischen Natur verabschiedet. Nicht, weil ich es nicht glauben möchte, oder es mir nicht vorstellen kann, sondern weil ich bereits Gegenteiliges erlebe. Es ist für mein Empfinden schließlich ein Unterschied, eine Form von «Dematerialisierung» zu erfahren mittels Bewusstseinserweiterung, und jene Bewusstseinserweiterung überspringen oder simulieren zu wollen mittels Technik. Im ersten Fall nämlich überschreiten wir uns selbst, im zweiten sind wir gefangen in dem Glauben, unser Menschsein sei etwas, das wir zu überwinden hätten.
Das entsprechend Gegenteilige, das ich seit ein paar Jahren erlebe und was mich doch Vertrauen in die Menschheit und ihre Zukunft schöpfen lässt, ist, dass immer mehr Menschen aufhören, sich im «Lebensverzicht» zu üben oder anderweitig in tote Welten abtauchen und stattdessen wieder anfangen, das Leben zu leben. Für mich wirkt es oft wie eine Milchglasscheibe oder Seifenblase, die – einmal zersprungen oder zerplatzt – alles, was ihnen bis dato als «Leben» versucht wurde zu verkaufen, in einem sehr sehr faden Licht erscheint. Supermärkte werden plötzlich zum Schaufenster milliardenschwerer Chemielabore und Krankenhäuser zu ihrer logischen Konsequenz. Währenddessen vermag kein Restaurantbesuch mehr wirklich zu schmecken und beim Durchqueren friedlicher Landschaften beginnen 5G-Masten Unbehagen auszulösen.
Für die Menschen, die diese «Realität» angefangen haben zu hinterfragen und sie entsprechend nicht mehr als letztgültige akzeptieren, gibt es meist nur eine Option: Sie erobern sich ihre Souveränität zurück, ihre Wirklichkeit nach ihren Wünschen und Vorstellungen zu gestalten. Einmal in dieser Kraft angelangt, verabschieden sie sich – wenn zunächst auch nur innerlich – von allem, was man ihnen immer glauben machen wollte, worin ihre Zukunft zu bestehen habe. Darunter besagte Technik, aber auch die «moderne» Medizin im Sinne von Bioengineering mitsamt ihren lebensverlängernden Versprechen (natürlich nur solange der Punkt der Singularität noch nicht erreicht ist).
Ich beispielsweise erlebe Menschen, die ihre Gesundheit anders «hacken». Nämlich indem sie zurückkehren zu richtigen Lebensmitteln, die sie entweder selber anbauen oder von Erzeugern in ihrer Nähe beziehen. Aber auch, indem sie allgemein weniger am Bildschirm sitzen, zurück in die Natur gehen, Bäume umarmen, meditieren oder sich anderweitig zurückbegeben in das Leben, was vielleicht schon ihre Vorfahren hat gesund – und glücklich – altern lassen. Die Rede ist von Gemeinschaften und sozialen Zusammenschlüssen, in denen das Leben gefeiert wird – und nicht seine Abschaffung. Und in denen entsprechend auch Kinder nicht länger als ihr Untergang, sondern als größte Hoffnung betrachtet werden, die diese Erde noch hat.
… Nur vielleicht mit dem Unterschied, dass in diesen Gemeinschaften – anders als vielleicht in früheren Zeiten – eines nicht untergeht: die ehrliche Kommunikation von Bedürfnissen. Mag zwar auch hier die Transformation erst dort beginnen, wo es unangenehm wird, transzendiert sich bei ihr schlussendlich das, was uns die «neuen Religionen aus dem Silicon Valley» versuchen zu nehmen: unser Gefühl.
Und wer weiß… vielleicht ist das auch eine Form von Rausch und Ekstase. Das Fühlen.
Für alle, die mehr über «Ehrliches Mitteilen» nach Gopal Norbert Klein erfahren wollen, empfehle ich entweder sein Buch «Der Vagus-Schlüssel zur Traumaheilung» oder die zahlreichen Videos auf seinem Youtubekanal.
Mein Buch «Das Gewicht der Welt» gibt es bei Tredition, Thalia, Exlibris, Orellfüssli, Amazon oder überall, wo es sonst noch Bücher gibt.
Mich wiederum findet ihr auf Telegram, Instagram, X oder Spotify.
Klein, G. N. (2022). Der Vagus-Schlüssel zur Traumaheilung: Wie »Ehrliches Mitteilen« unser Nervensystem reguliert. Gräfe und Unzer, Seite 25.
Ebenda, Seite 76f.
Heidegger, M. (1967): Sein und Zeit, Seite 125, vergleiche Seite 167.
Ebenda, Seite 184.
Sloterdijk, P. (1993). Weltfremdheit. Suhrkamp, Seite 261.
Ebenda, Seite 152.
Sloterijk (1993), Seite 120.
Jünger, E. (1978): Annäherungen, Seite 44.
Sloterdijk (1993), Seite 133.
Ebenda, Seite 140.
Ebenda, Seite 136.
Ebenda, Seite 141.
Ebenda, Seite 149.







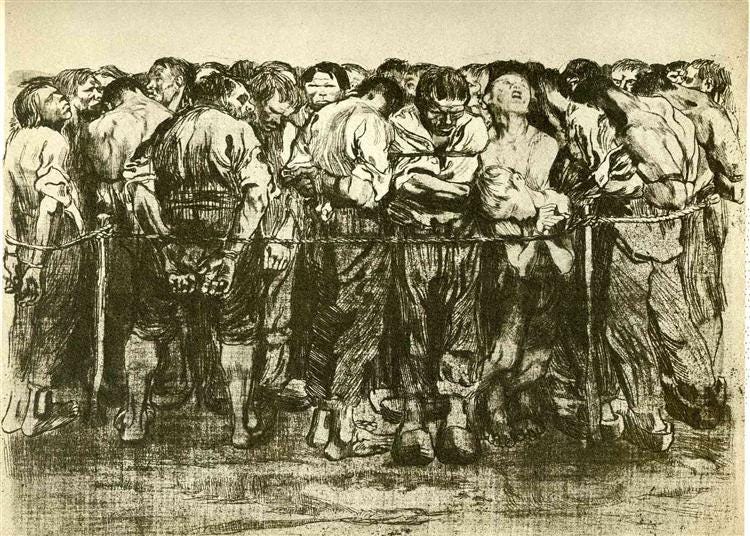


Sehr geehrte Frau Gebert,Sie erwähnen "Gemeinschaften" als mögliche Lösung bzw neue Form des Zusammenlebens von Menschen in denen ein lebendigeres Leben wieder möglich wird(falls ich Sie da richtig verstanden habe).Solche Gemeinschaften gibt es schon sehr lange,die Erfahrungen die dort gemacht wurden,besonders in Projekten die mehrere Jahrzehnte überlebt haben sind allerdings mehr wie ernüchternd denn alle Mitglieder nehmen ihre Neurosen und Traumata mit in die Gemeinschaft und agieren sie dort aus,das hat der Psychoanalytiker Horst Eberhardt Richter schon vor über Vierzig Jahren zutreffend beschrieben.Innerhalb solcher Lebensgemeinschaften ist erfahrungsgemäß die soziale Kälte deshalb oft noch größer als außerhalb und mich wundert es überhaupt nicht daß während der Coronazeit dort überall (bis auf eine Ausnahme im Projekt Tamera in Portugal)sofort hysterische Coronaangst ausbrach und zu zum Teil irrwitzigen "Hygienemaßnahmen"führte .Ich selbst arbeite seit Jahrzehnten in einem Gemeinschaftsprojekt,solche Gemeinschaften sind nicht die Lösung sondern erzeugen für ihre Mitglieder neue Probleme die sie sonst nicht hätten.
Toll, liebe Lilly, diese auf den Punkt gebrachte Analyse und Herleitung hin zur Zuversicht und der Erkenntnis, dass das Pendel endgültig in die andere Richtung geschlagen hat. Wie habe ich doch vor einiger Zeit in einem Spruch gelesen: das Neue ist längst da, das Alte macht nur noch viel Lärm. Wobei "das Neue" nicht wirklich neu ist, sondern es sich um eine Rückbesinnung, eine Rückerinnerung an all das, was schon immer da ist, handelt.
Re-cordari= Rückkehr zum Herzen, wie ich bei Roland R. Ropers gelernt habe.
Meinem Fühlen nach ist die Wahrnehmung, das Fühlen der Gefühle (und damit meine ich explizit nicht das Fühlen der Emotionen, die für mich nur in der Dualität erfahrbar sind) DER Zustand, das wahre Sein des Menschen. DAS kann kein vorübergehender Rausch sein.
Sich dieses Fühlens gewahr (bewusst) zu werden und zu bleiben, lässt mich mein eigenes Du in mir, d.h. die eigene in mir seiende Göttlichkeit (wieder) erleben, womit das Bindungstraume er-löst wird.
„Das Auge, mit dem ich Gott anschaue und das Auge, mit dem Gott mich anschaut, ist ein und dasselbe Auge“ (Meister Eckhart, 1260 – 1326)