«Es gibt Leiden, von denen man die Menschen nicht heilen sollte,
weil sie der einzige Schutz gegen weit ernstere sind.» — Marcel Proust
In meinem vorletzten Text schrieb ich viel von Vertrauen, genauer gesagt von Urvertrauen. Es folgte das Gespräch mit einer guten Freundin. Wir sprachen über Weltwahrnehmungen; und warum es dem einen gelingt, einen emotionalen Zugang zu sich und zur Welt zu finden und in diesem all’ seinen Sinnen zu vertrauen, während der andere sich auf seinen Kopf reduziert und in dessen rationaler Beschränkung die Welt zu be-greifen versucht, anstatt sie erst einmal nur zu be-obachten.
Wir fragten uns: Auf welche (fehlende) Urerfahrung lässt sich das (fehlende) Urvertrauen in die eigene Wahrnehmung, auf die Instinkte und das Bauchgefühl zurückführen? Auf das Erfahren oder Nicht-Erfahren von Bindung und bedingungsloser Liebe durch unsere Eltern im Mutterleib und als Säugling, auf Lernerfolge oder –Niederlagen wie Selbstunter- oder Überschreitungen als Kind, oder doch auf die erst später erfolgende Gewissheit oder Bestätigung, dass das Leben (nicht) damit endet, wenn wir ausgegrenzt werden oder Hass erfahren?
Wir für unseren Teil kamen zu dem Schluss, dass Erfahrungen, die wir in diesem Leben machen, zwar dazu führen, dass wir Selbstsicherheit, Selbstbewusstsein, oder bestenfalls sogar Selbstliebe entwickeln, dass sich aber das Gefühl, das wir meinen, nicht auf dieses Leben zurückführen lässt. Die Erfahrung von Urvertrauen, die Gewissheit, von etwas oder jemandem getragen zu sein, beschrieben wir beide als etwas, das nicht von dieser Welt zu sein scheint. Obgleich sie dazu führt, uns in dieser nicht zu verlieren. Und obgleich sie die stärkste Verbindung ist, die wir zu ihr haben.
Mit der Entfremdung nicht mehr fremdeln
Ich glaube, es gibt Dinge, die wir entweder haben, oder eben nicht. So zum Beispiel das Gefühl, nicht von dieser Welt zu sein. Ein Gefühl, mit dem ich, wie ich in meinem Text «Die Welt dazwischen» bereits schrieb, lange gehadert habe. Mit dem ich solange im Unfrieden war, bis der Unfrieden dieser Welt mir gezeigt hat, warum eigentlich Gegenteiliges der Fall sein sollte; warum es gerade in Zeiten wie diesen vielmehr als Geschenk zu betrachten ist, sich dieser Welt als solcher nicht zugehörig zu fühlen:
Ende 2019 ging ich für ein Semester nach Santiago de Compostela. Kiel, die Stadt, in der ich damals studierte, fühlte sich zunehmend an wie eine Sackgasse. Ich hatte niemanden, mit dem ich reden konnte, fühlte mich zusehends als Fremde unter Fremden. Von der Stadt der Pilgerer erhoffte auch ich mir ein «Ankommen». Vergebens. Auch hier fühlte ich mich isoliert, mehr denn je auf mich selbst zurückgeworfen. Als Mensch, der ungern Dinge abbricht, betrachtete ich Projekt Galizien als gescheitert und fuhr Anfang Dezember und mit seinem Dauerregen im Rücken die 2.500km zurück nach Schleswig-Holstein. Wenigstens meinen Geburtstag wollte ich so «feiern», als sei ich nicht der letzte Mensch.
Doch auch «Zuhause» «angekommen» vermochte ich meine Traurigkeit über den Zustand der Welt und ihre vermeintliche Leere nicht abzuschütteln. Gleich den Wolken Galiziens begleiteten auch sie mich auf Schritt und Tritt. Bis sie sich entluden: Als ob sich unsere gegenseitige Ablehnung derart kulminiert hätte, als dass sie keinen anderen Ausdruck mehr gefunden hat, als auch auf körperlicher Ebene auf sich aufmerksam zu machen, kehrte Anfang 2020 meine vergangen geglaubte Akne zurück, ehe zwei Monate später eine sogenannte Pandemie dafür sorgte, dass ich mit dieser Welt endgültig nichts mehr zu tun haben wollte.
Meine Akne, Corona, die Ausgrenzungserfahrungen durch einst geliebte Menschen: Rückblickend möchte ich nichts davon missen. Gleich meinen Narben im Gesicht haben mich all diese Momente der Isolation schlussendlich nur zu mir selbst zurückgeführt. Sie haben mich daran erinnert, dass alles, was ich im Außen erlebe, immer nur ein Spiegel dessen ist, was in meinem eigensten Inneren vorgeht. Wenn ich anfing, mich im Außen zu verlieren und nach der Bestätigung von Menschen zu suchen, denen nicht mein, sondern ausschließlich ihr «Glück» am «Herzen» liegt, dann nur weil ich mir diese Liebe und Wertschätzung nicht selbst geben konnte. Wenn ich anfing, mit der Welt als solcher nicht mehr im Frieden zu sein, dann nur weil ich selbst mit mir in einen Widerstand getreten war. Und wann immer ich anfing, mich falsch zu fühlen, dann weil ich mit mir selbst in eine Unehrlichkeit geraten war.
Für mich, wie für viele andere hoffentlich auch, war 2020 das Jahr der Ent-täuschung. Es hatte sich entlarvt, was ohnehin nie echt gewesen war, und gezeigt, was wirklich ist. Die Kluft zwischen dem, wer oder was unseres Vertrauens würdig ist, und wer nicht, stand nie offener als zu dieser Zeit. Nie zeigte sich deutlicher, zu wem eine wahre Verbindung besteht, und zu wem nicht. Nie war es einfacher, dahingehend eine Ausrichtung zu gewinnen, was wir in unserem Leben wollen, und wen nicht.
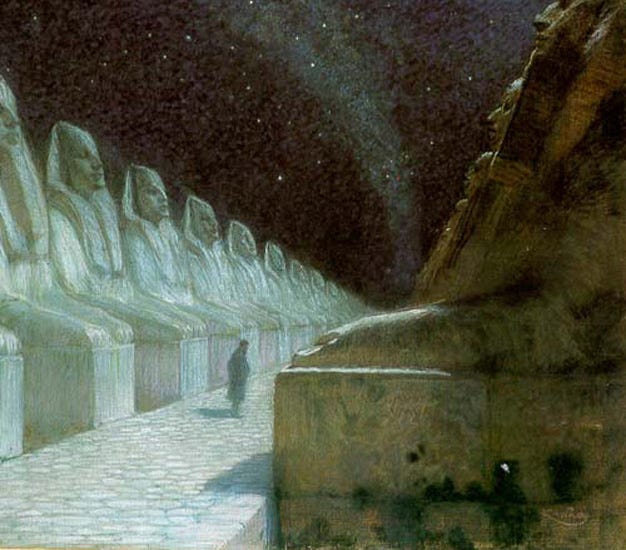

Und doch ist das, was «wir» aus dieser Zeit mitgenommen haben, nicht für alle gleich. Während mich meine Entfremdung gelehrt hat, dass nicht ich mir, sondern diese Welt sich selbst fremd geworden ist; vermochte manch anderer nicht den Weg zurück zu sich zu finden und ging stattdessen auf in dieser Abgespaltenheit. Während ich lernen durfte, dass mein Gefühl für die Entgleisungen dieser Welt mir meinen eigenen Weg schon weisen wird, gelang es manch anderem nicht, das nötige Vertrauen dahingehend zu entwickeln, dass, egal wie anders der eigene Weg von dem der anderen auch sein wird, er – solange er sich von seinem Gefühl leiten lässt – für ihn selbst der richtige sein wird.
Uns von unserem Gefühl leiten lassen. Ich glaube, das ist mitunter die wichtigste Lernaufgabe dieser Zeit. Oder mehr noch: Zu lernen, unsere Gefühle erstmals wirklich zu fühlen. Denn was bedeutet das, wenn wir mal ehrlich sind? Es meint die größte Reise, die wir auf dieser Welt erleben dürfen: die Reise in unser eigenes Inneres. Nicht nur festzustellen, dass wir Angst haben, sondern zu erforschen, warum wir Angst haben. Den Ursprung jener schlechten und selbstzerfressenden Gedanken ausfindig zu machen; und zwar nicht bloß in Form von Glaubenssätzen, sondern als den Schmerz, dem sie einst entsprangen. Unsere Gefühle zu fühlen heißt, mit jeder Zelle unseres Körpers das zu erleben, was diese Welt in uns für Spuren hinterlässt.
ㅤ
ㅤ
Wen dieses Thema vertiefend interessiert, dem empfehle ich diesen Artikel meiner lieben Freundin Anna. Ich für meinen Teil möchte an dieser Stelle dazu übergehen, welche Konsequenzen es auf gesellschaftlicher Ebene hatte und hat, dass viele Menschen sich lieber für ihren Kopf, anstatt für ihr Herz entschieden haben.
Ob das Wort «lieber» an dieser Stelle angebracht ist, ist durchaus in Frage zu stellen. Ich glaube, manche Menschen hatten schlichtweg keine andere Wahl. Und damit meine ich nicht ihre berufliche oder familiäre Situation, Abhängigkeiten auf emotionaler oder finanzieller Seite. Was das betrifft, hatte jeder Mensch eine «Wahl». Und doch haben sich viele Menschen nicht für ihr Leben, sondern für das Leben der anderen entschieden. Machten die Ängste der anderen zu ihren eigenen, übernahmen ihre Unmündigkeit, und lebten ihren Faschismus, als wäre er ihr eigener. All’ diese Entscheidungen, waren sie bewusster oder unbewusster Natur, entsprangen nicht den Herzen, sondern den Köpfen der Menschen. Entscheidungen auf Herzebene hätten anders ausgesehen. Ihre Quelle heißt schließlich nicht Ohnmacht, sondern Vertrauen.
Raus aus dem Kopf, zurück ins Gefühl
Mich persönlich ermüden die Analysen und Debatten über Massenpsychose und Propaganda. Nicht weil sie für manche Menschen nicht wichtig wären, sondern weil sie in meinen Augen den Kern der Dinge verfehlen: Was bringt Menschen dazu, lieber ihrem Kopf zu vertrauen, als ihrem Herzen? Wann hören Menschen auf, ihrem Bauchgefühl zu vertrauen? Warum kommen wir mit sechs Sinnen auf die Welt und gehen mit (k)einem? Was muss passieren, damit der Mensch anfängt, das, was er sieht, mit dem zu vergleichen, was er wahrnimmt? Wann lernt er, zwischen dem, was er hört, und dem, was er versteht, zu unterscheiden? Was muss noch passieren, damit der Mensch erkennt, dass das, was seine Nase gerne riecht, und das, worauf sie ihn zu stoßen versucht, zwei unterschiedliche Dinge sind?
Hier sind wir abermals beim Urvertrauen. Meine Freundin und ich kamen zu dem Ergebnis, dass dieses manchen Menschen – oder sollte ich besser sagen: Seelen? – angeboren sein muss. Denn sind wir mal ehrlich: Wie sehr haben wir im Anbetracht der letzten vier Jahre versucht, einen grünen Faden zwischen denjenigen ausfindig zu machen, die all’ dies nicht mit sich machen lassen haben? Wo sind die Parallelen? Gibt es eine Art Bauplan für den widerständigen Menschen, den Waldgänger? Können wir Kinder so aufwachsen lassen, dass sie gegen jede Form von Propaganda, Ideologie und Faschismus immun sind? Die Zeit, die ich mit Gunnar verbringen durfte, war geprägt von Fragen wie diesen: Wie konnte das passieren? Wie kommen wir da wieder raus? Wie können wir verhindern, dass sich die Geschichte wiederholt?
Egal wie viele Bücher wir wälzten und schlaue Menschen interviewten: Eine wahrhaft befriedigende Antwort fanden wir nie. Wobei ich mich mittlerweile auch eher frage, ob ihr Ausbleiben nicht mehr an unseren Fragen, sprich an unserem Fragen als solchem lag, als an den Antworten selbst. Ist es nicht ebenso eine Illusion, eine Art Wunschdenken, meinen oder glauben zu wollen, wir könnten etwas «verhindern»? Geht es wirklich darum, den Lauf der Welt aufzuhalten? Oder ist der Versuch, den Dingen entgegenzuwirken, nicht bloß ein weiteres Symptom unseres eigenen Widerstands? Wollen wir die Dinge verhindern, weil wir glauben, dass die Welt ohne sie eine bessere wäre, oder weil wir nicht wahrhaben wollen, insgeheim einer für uns bestimmten Lernaufgabe gegenüberzustehen? Was ist Antizipation und was Verdrängung? Wo fängt Integration an und wo hört Abspaltung auf?
Ich glaube, die größte Lernaufgabe in unserer Beziehung zur Welt besteht darin, alles, was uns in ihr widerfährt, als Lernaufgabe zu betrachten. Und sind wir einmal auf dieser Ebene angekommen, fallen viele unserer zuvor gestellten Fragen weg, sie wirken wie nicht mehr relevant. Einmal damit angefangen, alles, was auf dieser Erde geschieht, aus seelischer oder karmischer Perspektive zu betrachten, gibt es wie kein zurück mehr zum rein Rationalen, zum Menschengedachten. Wir verstehen im Herzen, nicht im Kopf.
Warum es manchen Menschen leichter als anderen fällt, diesen Blick einzunehmen, darüber konnten auch wir nur mutmaßen: Liegt es am Alter unserer Seelen? Sind es Erfahrungen eines früheren Lebens, auf die wir in diesem zurückgreifen können? Oder ist es schlicht die Unterschiedlichkeit unserer Lernaufgaben hier auf Erden, die bei dem einen damit beginnt, seinen Verstand zu überwinden, während der andere daran zerbricht, sich selbst zu finden?

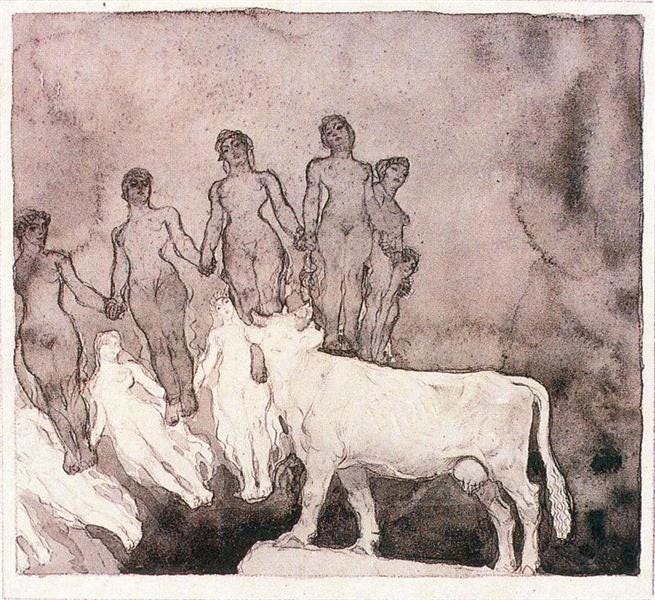
Wieder lernen, uns tragen zu lassen
Gleich es, so würde ein weiterer sehr lieber Freund jetzt sagen, auch Dinge gibt, die wir insofern als «Zufälle» bezeichnen könnten, dass sie sich sowohl außerhalb unseres Wirkungsbereiches befinden wie auch dahingehend keiner «Sinnhaftigkeit» unterliegen, dass wir von ihnen lernen könnten, glaube ich im Großen und Ganzen schon daran, dass alles in dieser Welt darauf ausgerichtet ist, uns an etwas Höheres zurückzubinden. Jede Pflanze, jedes Tier, jeder Grashalm, jede Ameise: Alles Leben strebt nach Wachstum. Dieses Wachstum kann Leiden bedeuten, es kann Ohnmacht und Verlust bedeuten. Doch am Ende ist es immer eines: Wachstum.
Haben wir einmal verstanden, dass, wenn nicht wir unser Leben leben, sondern das Leben uns in seine Bahnen wirft, wir zwar weiterhin wachsen werden, dieses Wachstum aber umso schmerzhafter (und unbewusster) ablaufen wird, je mehr wir uns und unsere Sinne verleugnen und je mehr wir uns dagegen wehren, uns und unserem Leben seinen eigenen Sinn zu verleihen. Frieden tritt erst ein, wenn wir verstehen und zu akzeptieren lernen, dass uns das Leben zwar widerfährt, dass uns in unserem Leben aber immer nur genau das begegnet, woran wir auch wachsen können (was uns nicht dazu veranlassen sollte, Menschen oder die Begegnung mit ihnen auf ihre Funktion als für uns stattfindende «Lernaufgabe» zu reduzieren).
Urvertrauen bedeutet für mich, aus der Trennung herauszutreten. Aus der mit uns selbst wie der zur Welt. Zur Erde. Zu lernen, dass wir gleichzeitig frei und verbunden sind; immer und überall und unter allen Umständen. Dass wir niemandem gegenüber «Rechenschaft» schuldig sind als gegenüber uns selbst und unserer inneren Stimme. Und dass, wenn wir ihr folgen, wir auch die Freiheit haben, selbst zu entscheiden, wie wir uns gegenüber etwas oder jemandem, kurzum: dem Leben gegenüber fühlen.
Urvertrauen bedeutet für mich, darauf zu vertrauen, dass unsere Seele einen Plan hat. Und dass uns selbst die größten Schmerzen schlussendlich dahin zurückführen, wo wir wahrhaft und allein Heilung erfahren können: in uns selbst. In die Liebe.





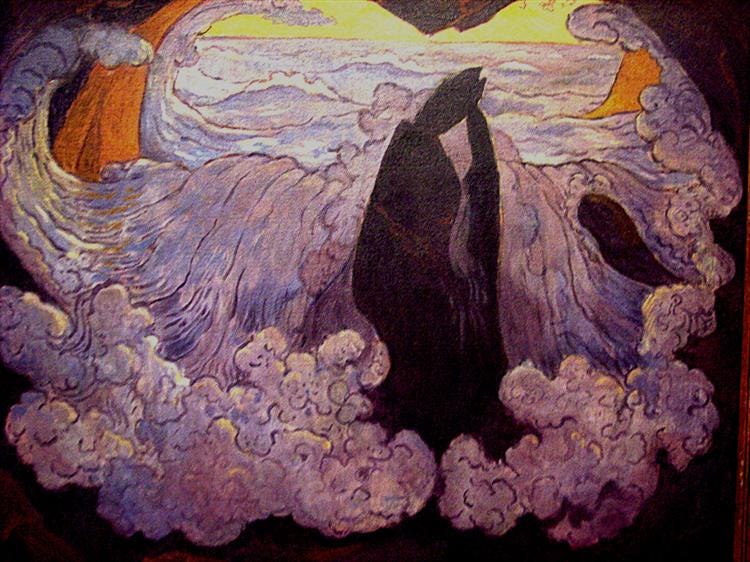
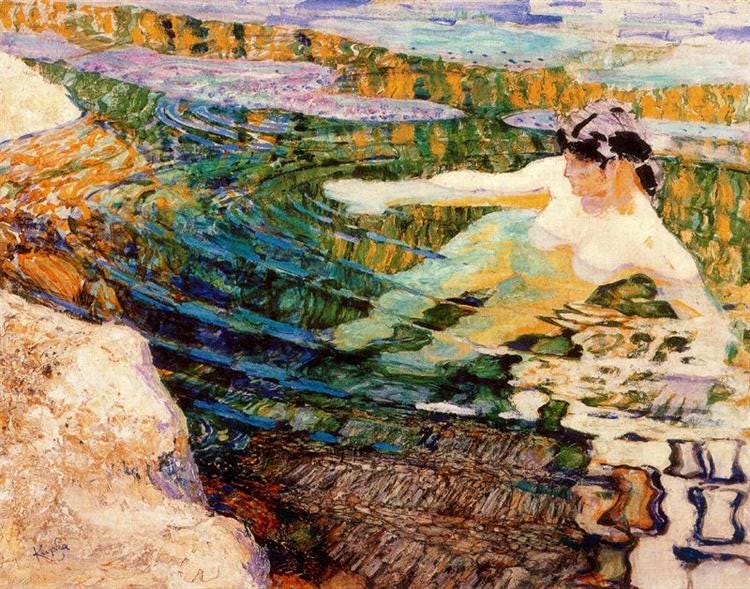
Liebe Lilly,
danke für diesen schönen und wahrhaftigen Text zum Maianfang.Alles sprießt und das Leben sagt an vielen Stellen,JA..
Das Ende der Ent-Täuschung ist auch meinem Empfinden nach wie der Wechsel in eine neue Umlaufbahn.Meine Frau machte mich vor einigen Jahren darauf aufmerksam und da wir jeden Tag mit Augenblicken und Enttäuschungen konfrontiert wurden,
war die vermeintliche Erkenntnis der Ent-Täuschung so vollkommen,dass ein Ausweg, der Weg ins möglichst ungetäuschte und zu entdeckende Innere war.
Es war von Höhen und Tiefen geprägt,dieses Tor geöffnet zu bekommen und selbst hindurchzuschauen und in kleinen Schritten hindurch zugehen.
Doch es war lichtvoll und fühlte sich nach Anstrengungen,die wichtig waren,immer mehr vollkommen an.
Diese Welt trägt man dann stets in sich
und begegnet ihr überall,nur nicht an jeder Ecke:)
Schön das Du und andere auch dort sind.
Ich wünsche uns allen eine schöne Weiterreise in die lebendige Innere Welt..
Herzliche Grüße David
Liebe Lilly,
das ist ein wirklich guter und schöner Text.
Herzlicher Gruss Doris